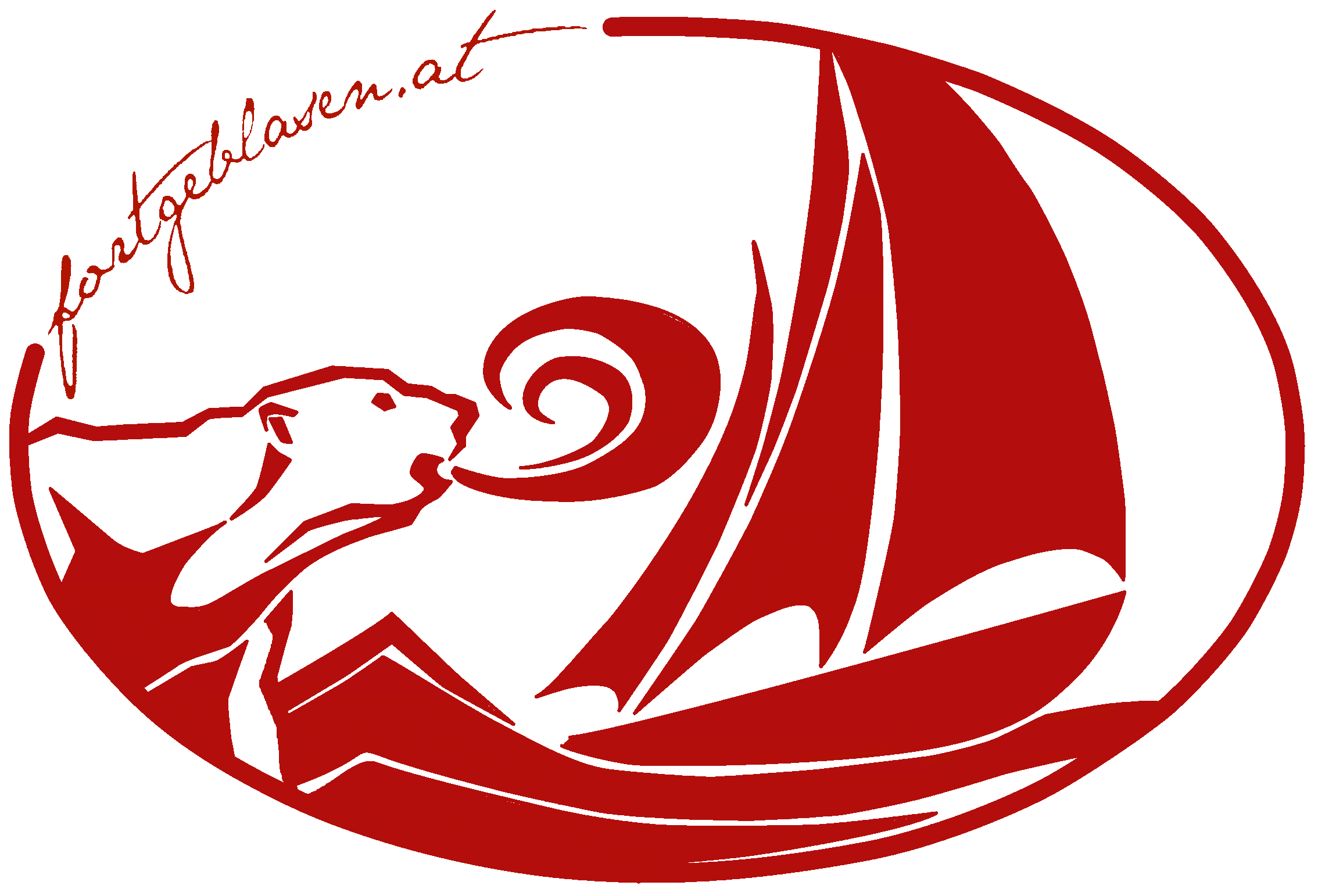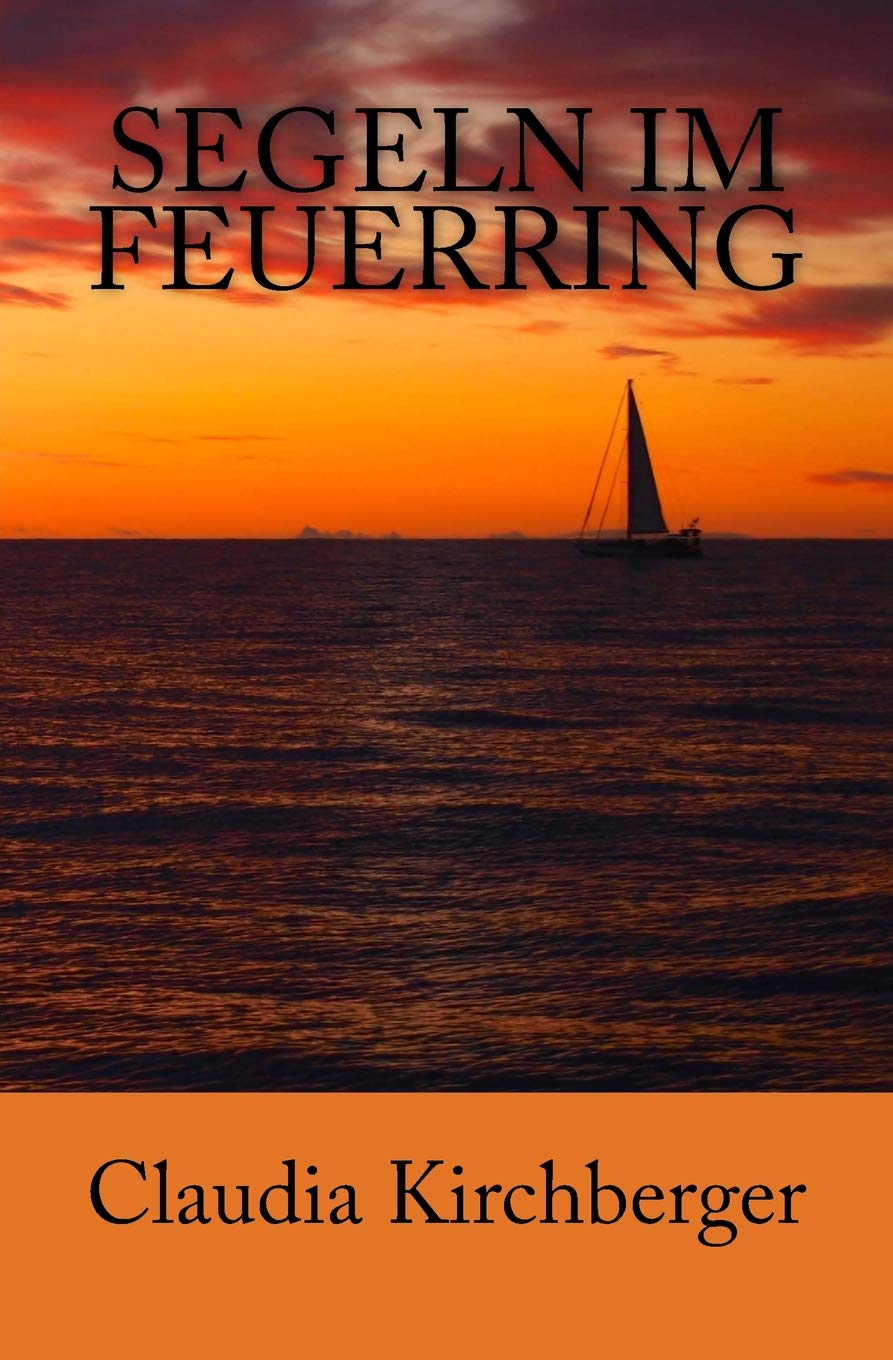SEGELN IM FEUERRING – Leseprobe
von Claudia Kirchberger
Im gefährlichen Archipel
Seewetterbericht vom 16. Mai: Stabile Passatwinde mit 4 Beaufort aus Ost. Südlich der Tuamotus Inselgruppe ein Tief mit östlicher Zugrichtung. Passatbewölkung, am Sonntag zunehmende Bewölkung, eventuell Regenschauer und kurzzeitig auffrischender Ostwind auf 5 Beaufort. SOI: -10 seit zwei Wochen
Vor uns liegen über fünfhundert Seemeilen zur nächsten Inselgruppe von Französisch Polynesien. Den Tuamotus Archipel. Die vom Wind geblähten Segel blenden im Sonnenlicht. Stolz trägt LA BELLE EPOQUE ihr Kleid: Besan, Großsegel und Genua. Niedrige See schiebt das Boot nach Süd-Südwest. Unter dem Bimini baumeln zwei Bananenstauden. Ein Stück hinter dem Segelboot springt ein Köderfisch aus Kunststoff an einer Angelleine auf der Wasseroberfläche. Im Cockpit geht´s gemütlich zu: Auf Matratzen und Polstern liegen wir faul im Schatten abgespannter Stofftücher und lesen. Zwischendurch blickt einer von uns entlang der tiefblauen Wasserfläche in den Horizont. Nichts unterbricht das endlose Blau, keine Seele scheint hier draußen zu sein. Nie haben wir eine derart einfache und ruhige Ozeanpassage erlebt.
Die Bewölkung mit Regen erreicht uns nicht – leichte Passatwölkchen, gleißendes Sonnenlicht und ruhige See begleiten uns. Am vierten Tag steht fest, dass wir zu schnell sind.
Wir werden die Tuamotus Inselgruppe nachts erreichen. Das kann gefährlich werden. Mit Vorsicht muss zwischen den Atollen navigiert werden: Heimtückische Strömungen zwischen flachen Inseln, die von Weitem unsichtbar sind. Sie bestehen aus Korallensand, auf denen Palmen wachsen. Die Einfahrten in die Atolle sind gespickt mit Korallenköpfen, zwischen denen rasante Strömungen die Passagen erschweren. Viele Ankerplätze sind voll von Korallen, um die sich die Ankerketten wickeln, bis die Yachten zornig an ihnen reißen. Nicht umsonst gab Kapitän Cook der Inselgruppe den klingenden Namen „das gefährliche Archipel“.
Unser erstes Atoll wollen wir auf keinen Fall nachts erreichen. Wir reffen die Segel, drehen schließlich bei. Zum Sonnenaufgang tauchen die Palmen von Makemo vor dem Bug auf. Aus gutem Grund haben wir Makemo gewählt. Die Riffpassage in das Atoll ist breit und gut sichtbar, die Seekarten stimmen und die lange Dünung des Pazifiks bricht sich auf der anderen Seite des Atolls. Noch im Morgenlicht ziehen wir gegen die leichte Strömung durch die Passage und ankern neben BELLA VITA. Sie verließ ein paar Tage vor uns Nuku Hiva.
Was für ein Gegensatz zu den Marquesas Inseln. Die Inselgruppe der Tuamotus ist älter – so alt, dass die eigentlichen Inseln längst versunken sind. Wie bei den Marquesas waren hier Vulkane am Werk – brachen einst aus der Wasseroberfläche und wuchsen zu Bergen. Die Vulkanberge erkalteten, reiche Vegetation wuchs auf ihnen. Entlang ihren Küsten formten sich Riffe gefüllt mit Leben. Doch hier zu leben war niemals leicht. Mit zermürbender Geduld arbeitete der Pazifik gegen die Korallen. Welle für Welle brach sich der Ozean unbarmherzig über die Außenkante der Korallenköpfe, bis sie zu Sand zerfielen und einen weißen Ring aus Korallensand um die Vulkanberge aufwarfen. Nichts währt ewig, über die Jahrhunderte begannen die Vulkanberge der Tuamotus zu versinken, bis das Wasser über ihren Gipfeln zusammenschlug. Zurück blieben die Ringe aus Korallen und Sand, in deren Mitte keine Berge, sondern seichte Pools Salzwasser standen. Lagunen, die das Leben im Pazifik bis heute feiern und mit Fischen, Korallen, Muscheln und Krebsen gefüllt sind. Atolle waren entstanden. Das Meer schlug Passagen durch das Riff, versorgte die Lagunen mit frischem Wasser. Bei manchen Atollen entstand ein Pass groß genug, dass Boote, sogar kleine Schiffe, ihren Weg bis ins Innere der Lagunen wagen konnten.
Stets weht eine leichte Brise übers Deck, kühlt uns trotz gleißender Sonne. Ausgerüstet mit Schnorcheln und Flossen erkunden wir die fremde Welt unter uns. Das wahre Erlebnis der Tuamotus Atolle liegt unter Wasser: in den Gärten der Meere. Eine fantastische Verschwendung an Formen und Farben wartet auf uns: Korallenköpfe in allen denkbaren Mustern, Fische so bunt, wie sie in den besten Aquarien kaum zu finden sind. Muscheln, die ihre farbenfroh leuchtenden Lippen in der Strömung öffnen und Tintenfische, die sich so gekonnt tarnen, dass wir wenige entdecken. Die Flut setzt ein, der Pazifik strömt durch den Pass ins Atoll. Auch in der Einfahrt kann nun geschnorchelt werden. Die Strömung treibt uns nicht ins offene Meer. Trotzdem halten wir uns an dem Dingi fest. Bereit, an Bord zu hüpfen und mit Hilfe des Außenborders aus der Strömung zu fliehen.
Die Flut zieht uns über beeindruckendste Unterwassergärten. Ein Handzeichen von Jürgen und mir bleibt das Herz fast stehen: Hautnah beobachte ich meinen ersten Hai. Gemächlich schwimmt das Tier an mir vorbei, ohne das geringste Interesse zu zeigen. Der Hai ist nicht alleine, ein paar Grauhaie und Schwarzspitzen suchen das Riff ab, folgen und umkreisen uns. Wir behalten sie im Auge, fasziniert von ihrem Äußeren, ihren geschmeidigen Bewegungen. Unbemerkt treibe ich einen Hai ins zu seichte Wasser. Er dreht, schießt auf mich zu. Atemlos flüchte ich ins Dingi – genug geschnorchelt für heute!
Ein Atoll per Segelboot zu durchqueren gehört zu den Abenteuern der Südsee. Korallenriffe wachsen rascher als Atolle vermessen werden, die wenigen Tiefenangaben der Seekarten stimmen längst nicht mehr. Wir wollen durch Makemo segeln, uns einen Weg durch die Riffe suchen. Vor einem einsamen Motu ankern.
Frühmorgens holen wir den Anker auf Deck, setzen die Segel und halten Ausschau. Die Sonne steht hinter uns, beleuchtet die Korallenköpfe, ohne uns zu blenden. Jürgen gibt vom Bugsprit aus Handzeichen. Der laufende Tiefenmesser ist nutzlos, die Korallenköpfe wachsen senkrecht vom Meeresboden in die Höhe. Ich lese dreißig, vierzig Meter Wassertiefe, keine Bootslänge entfernt lässt ein Korallenblock das Wasser türkis schimmern. Nach fünfzehn Seemeilen erreichen wir unser Ziel keine Minute zu früh: Die Sonne steht bereits hoch am Himmel. Sie wandert in den Westen, blendet uns. Ihr Licht spiegelt sich auf der Wasseroberfläche. Ein sicheres Navigieren durch die Riffe ist unmöglich geworden.
Wir ankern hinter einem ausgedehnten Korallenriff, verdecken die Segel mit Persenninge und staunen über die Einsamkeit. Keine andere Yacht ist hier, die einzelne Hütte am Strand wirkt verlassen. Hand in Hand wandern wir über das Motu, sammeln grüne Kokosnüsse und trinken ihr frisches Wasser. Wir schnorcheln übers Riff und betrachten den Sonnenuntergang vom Cockpit aus.
Makemo verfügt über eine zweite Riffpassage entlang der Nordflanke des Atolls. Es ist nicht nötig, zurück zu segeln. In unserem Kielwasser passiert BELLA VITA den Pass. Sie wird nur kurz hinter uns bleiben. Die fünfzig Fuß Yacht ist eine schnelle Seglerin. Seit Arek und Iwona Spaß an ihrem Ketschrigg gefunden haben, läuft sie stets mit maximaler Segelfläche. Hier zwischen den Tuamotus Inseln macht Segeln richtig Freude: Steifer Passatwind füllt die Segel, während die See im Schatten der Atolle ruhig bleibt. Allerdings muss sorgfältig navigiert werden. Das Land ist niedrig, die Palmendächer sinken aus geringer Entfernung hinter dem Horizont. Sie sind nicht leicht auszumachen.
Obwohl die Seekarten in diesem Teil der Tuamotus relativ genau sind, stranden immer wieder Yachten auf ihren Riffen. Kleine Fehler, fatale Misseinschätzungen, Übermüdung und falsche Entscheidungen können zu einer Kettenreaktion führen, an deren Ende bestenfalls die Aufgabe der Segelyacht steht. Auch wir werden über Funk ein solches Drama miterleben. Tage nachdem wir in Fakarava einlaufen, strandet ein amerikanisches Boot am Außenriff.
Wir haben die Lagune von Fakarava durch ihre südliche Einfahrt erreicht. Bunte Yachten gefüllt mit lebenslustigen Surfern und Lebenskünstlern, Aussteigern, Urlaubsseglern und Blauwasserseglern füllen das Ankerfeld. Fakarava zieht besonders Taucher jeder Altersgruppe an. Das Atoll, vor allem die südliche Passage durchs Riff, verfügt über eine nervenaufreibende Besonderheit: die Parade der Haie.
Der Name ist Programm: Mehr als vierhundert Tiere versammeln sich im Flutstrom des Passes. Sie patrouillieren die Einfahrt, formen eine Mauer aus Tierkörpern am Außenriff und stehen – immer mit Blick in Richtung Ozean – in der Strömung. Die Raubfische versammeln sich direkt vor dem Atoll, verweilen vor dem Riff in wenigen Meter unter der Oberfläche bis in die Dunkelheit der Tiefe. Warum sie sich so verhalten und was sie dazu treibt, sich hier zu sammeln, darauf finden wir keine Antwort. Gerade Pässe von Atollen sind wahre Hochburgen des Lebens. Vielleicht entspannen sich die Haie im strömenden Wasser nach nächtlicher Jagd. Es gibt auch die Vermutung, dass sie die Strömung und die reiche Tierwelt des Passes für die Reinigung ihrer Haut nutzen, oder dass sie sich zur Fortpflanzung treffen. Unumstritten bleibt, dass sie mit ihrem Verhalten abenteuerlustige Taucher und neugierige Schnorchler in die Riffpassage locken.
In Neoprenanzügen und mit der Schnorchelausrüstung bewaffnet düsen wir im Beiboot rechtzeitig vor dem Einsetzen der Flut ans Außenriff des Südpasses. Mit leichtem Unbehagen lasse ich mich langsam ins Wasser gleiten, bedacht, keine ausholenden Bewegungen und platschende Geräusche zu machen. Immerhin habe ich gelesen, dass Haie mit Hilfe ihres feinen Gehörs kränkliche Tiere aus Fischschulen suchen. Ich will nicht als „kränklicher Schwimmer“ identifiziert werden.
Unter mir ändert sich das strahlende Blau der oberen Wasserschichten in ein dunkles, klares Kobaltblau. Die Sonne steht hoch, ihre Strahlen schießen helle Lanzen durch die Wasseroberfläche, bringen die Welt um mich zum Glänzen. Dass Riff, an dessen Kante ich entlang schwimme, ist gefüllt mit Leben. Einige Tunfische treiben gemächlich an der Korallenwand, ein Rochen zieht mit eleganten Flügelschlägen an mir vorüber. Trompetenfische reflektieren das Sonnenlicht. Sie glitzern, als hätte jemand silbernes Lametta ins Wasser geworfen. Ein Napoleonfisch hält sicheren Abstand zu mir. Im Schutz der Korallen tummelt sich kleines Leben. Bunte Lippfische schwimmen flink in ihr Versteck zwischen Korallenästen, sobald sie Gefahr ahnen. Einzelne Papageienfische verzaubern mit ihren einzigartigen Zeichnungen. Eine Muräne beobachtet mich skeptisch aus ihrer Höhle.
Die Flut hat eingesetzt. Sie treibt mich gemächlich zurück in die Sicherheit des Atolls, während sich unter mir die Parade der Haie formt. Mir läuft ein kalter Schauer über den Rücken, mein Herz pumpt pures Adrenalin durch die Adern. Ich kann diese Masse von Raubtieren wenige Meter von mir kaum begreifen. Unzählige Tiere haben sich versammelt, stehen in der Strömung, Reihe an Reihe. Hunderte – übereinander, untereinander, nebeneinander. Sie bewegen ihre makellosen Körper nur träge, um nicht ins Innere der Lagune getrieben zu werden. Ich versuche, die verschiedenen Arten zu bestimmen. Zu erkennen, ob sich unter die Riffhaie auch Räuber aus der Hochsee gesellt haben. Meine Finger umschließen krampfhaft die Trosse des Dingis, ich bewege mich nur Meter neben dem vermeintlich rettenden Boot, schleppe es hinter mir her.
Meine Sinne sind angespannt. Kann ich die Streifen eines Tigerhais entdecken? Haben sich Hammerhaie zu den unzähligen Grauhaien gemischt? Kann ich überhaupt den Unterschied zwischen mehr oder weniger gefährlichen Tieren erkennen? Vor allem sehe ich Grauhaie. Die vielen Schwarzspitzenhaie haben sich nicht der Parade angeschlossen. Sie tummeln sich lieber am Riff. An ihren Anblick habe ich mich, so gut es geht, gewöhnt. Seit wir in den Tropen segeln, vergeht kein Badetag, ohne harmloser Begegnung mit dieser Haiart. Auf flachen Stellen zwischen den Korallenköpfen entdecke ich Weißflossenhaie und Ammenhaie.
In der Zwischenzeit hat sich die Flut verstärkt. Immer schneller zieht mich die Strömung über die Mauer aus Raubfischen, bis der Pass seichter wird. Nun vereinzeln sich die stehenden Haie, ich kann zu allen Seiten unter mir die bunte Welt der Korallen bestaunen. Das Wasser ist noch an die sechs oder sieben Meter tief, ich treibe an einem in der Einfahrt verankerten Katamaran vorüber. Ein Charterboot, das sich auf die Tauchreviere der Tuamotus Inseln spezialisiert hat.
Das Verhalten der Haie hat sich im untiefen Wasser der Einfahrt verändert. Die Tiere stehen nicht in der Strömung, sie patrouillieren das Riff, schwimmen aufmerksam umher, ziehen Kreise. Unbeeindruckt von Menschen kommen sie mir haarsträubend nahe. Aufgeregt beobachte ich Jürgen. Er bleibt nicht in der unmittelbaren Nähe des Beiboots, schwimmt in ausholenden Flossenschlägen kreuz und quer über die Korallenwelt. Ich kann ihm seine Faszination von diesem Element ansehen. Er tätschelt die Wasseroberfläche mit seiner Handfläche, bis Schwarzspitzenhaie neugierig auf ihn zuschwimmen. Haie haben schlechte Augen, sie fühlen die Bewegungen im Wasser, sehen aber erst aus geringer Entfernung ihre Ursache. Sobald ein Hai dicht bei Jürgen schwimmt, lässt er mit Schwung den ganzen Arm auf die Wasseroberfläche klatschen. Erschrocken haut der neugierige Besucher in sichere Entfernung ab. Fasziniert beobachte ich Jürgens Spiel. Die Schwarzspitzenhaie tummeln sich wie junge Hunde um ihn. Bald haben sie den Dreh heraus. Es scheint, als machte ihnen das Spiel Spaß.
Wenige Meter unter mir entsteht nervöses Gedränge. Mit elektrisierenden Bewegungen schießen die kreisenden Grauhaie wiederholt auf eine Spalte in den Korallen zu. Ein verwundeter Fisch muss dort ausharren, oder die Crew des Tauchbootes hat absichtlich Fischabfälle versenkt. Die Haie versuchen von allen Seiten die Beute aus dem Versteck zu treiben. Sie scheinen ihren Kopf verloren zu haben, von blinder Gier getrieben zu sein. Erneut jagt mir ein kalter Schauer über den Rücken. Jetzt eine Verletzung, etwas Blut im Wasser, ein paar tollpatschige Bewegungen. Die Gedanken reißen nicht ab. Ich fühle mich nicht wohl. Mit wenigen Flossenschlägen bin ich beim Beiboot, ziehe mich in die freundliche Wärme des Sonnenlichts der Tropen.
Die kommenden Tage treibt es uns erneut zum Hai-Spektakel. Manchmal schnorcheln oder tauchen Arek und Jürgen, während Iwona und ich uns zum Tratschen treffen. Erleichterung überkommt mich, wenn das Dingi mit ihnen zurück zum Ankerplatz kommt.
Die verankerten Yachten werden täglich von Haien umkreist. Sie suchen nach frischen Fischabfällen.
Gefischt wird in den Atollen am besten mit der Harpune. Ein Abenteuer für sich. Mit dem Dingi fahren wir ins Innere des Atolls, bringen Distanz zwischen uns und dem haiverseuchten Pass. Nahe den nervösen Haien ist uns das Harpunenfischen zu gefährlich. Für diese Ausflüge sind wir stets gemeinsam mit weiteren Seglern oder Einheimischen unterwegs. Drei bis vier Schwimmer bleiben in der Nähe des Harpunen-Jägers. So zeigen wir den Haien in der Lagune, dass wir keine leichte Beute sind. Ist ein Fisch geschossen, muss er möglichst schnell aus dem Wasser. Die Bewegungen eines sterbenden Fisches sowie der Geruch nach Blut sind zu verlockend für die Haie. Ein Schwimmer bleibt deshalb immer mit dem Dingi nahe am Geschehen.
Befinden sich Fang und Jäger in Sicherheit, ist die Gefahr des Fischens in den Atollen längst nicht gebannt. Frische Korallenfische zu verspeisen heißt, sich mit der Fischvergiftung Cigatera herumzuschlagen. Fische nehmen den Giftstoff von sterbenden Korallen auf. Es handelt sich um ein Nervengift, das für Fische unschädlich bleibt. Beim Menschen können die Auswirkungen einer Vergiftung von lästigen Irritationen bis zur Lebensbedrohung reichen. Cigatera-Gift kann im menschlichen Körper nicht abgebaut werden, es sammelt sich mit der Zeit: Je mehr Rifffisch gegessen wird, desto wahrscheinlicher werden Vergiftungserscheinungen auftreten.
Auch in den Fischkörpern sammelt sich das Gift, weshalb nicht alle Fische gleichermaßen von Cigatera betroffen sind. Anfänglich vertrauen wir auf das Urteil von Einheimischen. Wer, wenn nicht die Menschen des Riffes, können wissen, welche Fischarten mehr oder weniger betroffen sind. Doch wir erhalten so viele unterschiedliche Empfehlungen, wie wir Polynesier befragen. Empfehlungen von „Kein Problem, ich esse immer diese Fische“, bis „Um Gottes Willen, greift bloß diese nicht an!“
Trotzdem erfahren wir bald wichtige Grundlagen: Ältere Raubfische haben höhere Mengen Cigatera angesammelt als jüngere, weshalb nur kleinere Fische gejagt werden dürfen. Manche Rifffische gelten als unbedenklicher. Fische, die sich nicht vom Riff selbst ernähren, sind die beste Wahl. Wir Harpunieren nur selten einen Rifffisch. So sehr uns frischer Fisch auf unserm Mittagstisch fehlt, Dosenfisch ist der ungefährlichste Fang.
Wir müssen nicht auf alle Spezialitäten des Korallenriffs verzichten. Es ist Vollmond, Zeit der Springtide und damit Jagdzeit für eine besondere Delikatesse: Hummer.
Bei Dunkelheit wandern wir mit Taucherstiefeln an den Füßen über das Riff. Zwei Beiboote liegen verzurrt auf der ruhigen Innenseite eines Motus. Eine blinkende Stirnlampe in den Zweigen eines Busches wird uns später helfen, den Weg zurück zum Motu zu finden. Mit fallendem Wasser werden wir die halbe Nacht über das trockenfallende Außenriff dem Ozean entgegenlaufen, in von der Ebbe geformten Wasserlachen nach Hummer jagen.
Die Jagd am Außenriff ist gefährlich. Korallen haben messerscharfe Kanten, in vielen Ebbpools warten eingeschlossene Haie. Rutschige Oberflächen und spitze Korallen können den sicheren Tritt verhindern. Wir müssen aufpassen, ein Fall kann zu schlimmen Schnittverletzungen führen. Ärztliche Hilfe ist meilenweit entfernt.
Wir schalten die mitgebrachten Taschenlampen aus. Der Mond beleuchtet die Szene, die Augen gewöhnen sich rasch an die Dunkelheit. Der Wind raschelt in den Palmblättern des Motus, das Rascheln mischt sich mit dem Rauschen der Brandung auf der Riffkante. Die Ebbe hat bereits eingesetzt, die Korallenbänke vor dem Motu liegen frei. Wir laufen über ihre Köpfe dem Meer entgegen. Anfänglich mit vorsichtigen Bewegungen, später mit sicherem Schritt. Angespannt suche ich die Salzwasserlachen zwischen den Korallen auf Bewegungen ab. Nicht sicher, wonach ich Ausschau halte. „Sie leuchten etwas grünlich im Mondlicht, keine Sorge, wenn du den ersten Hummer gesehen hast, weißt du, wonach du suchst“, lässt mich Graig von Bord der FREE SPIRIT wissen. Ich sehe nur ein paar Papageienfische.
Im wasserfesten Rucksack trage ich einen leeren Eimer. Dann ein Ruf. „Ich hab einen!“ Ich eile zu Graig, der einen Hummer aus dem Wasser hebt und in der Hand umdreht. Zwischen den Beinen des Tieres leuchten hunderte rote Eier im Licht der Taschenlampe. Es handelt sich um ein tragendes Weibchen, leicht enttäuscht lässt Graig seinen Fang zurück ins Wasser gleiten. Zwei kräftige Schwanzschläge und der Hummer ist unter einer Koralle aus unserem Blickfeld entschwunden. „Hast du gesehen? Das ist der Grund, weshalb wir Hummer mit den Händen fangen, anstelle sie zu Harpunieren! Sonst wäre das Riff bald leergefischt.“
Die Hummer der Südsee haben keine Scheren, aber Spitzen auf ihren Panzer. Wir tragen Taucherhandschuhe, um uns nicht zu verletzen. Sie ohne Harpune oder Speer zu jagen, braucht Gespür. Graig behält recht, nachdem ich seinen Fang davon schwimmen sehe, weiß ich, wonach ich eigentlich suche. Ich entdecke das nächst Tier. Vorsichtig bewege ich mich näher, halte die Taschenlampe direkt in seine Augen. Geblendet bleibt der Hummer unbeweglich sitzen. So schnell ich kann, packe ich ihn mit der freien Hand und rufe den anderen zu. „Lass ihn bloß nicht aus! Auch wenn er zu vibrieren beginnt.“ Noch während Graig mir zuruft, beginnt der Hummer unter der Hand zu zucken. Versucht, mich mit seinem Schütteln zu erschrecken. Ich muss die Zähne zusammenbeißen, um den Impuls, die Hand zu öffnen, zu unterdrücken. Gleichzeitig krallt sich der Hummer mit seinen zahlreichen Beinen an der Koralle fest. So sehr ich auch ziehe, er scheint Tonnen zu wiegen. Jürgen ist bereits an meiner Seite, lässt seine Hand vorsichtig zwischen meine und den Rücken des Tiers gleiten, zieht es aus dem Wasser. Der Hummer ist an die vierzig Zentimeter lang, groß genug. Ein kurzer Blick auf seine Unterseite – keine Eier – schon steckt er in meinem Rucksack.
Wir laufen über das Riff, können an den Lichtern der Taschenlampe sehen, wie weit wir voneinander entfernt sind. Immer größer wird die von der Ebbe freigelegte Fläche, eine Mondlandschaft aus Korallenköpfen und Wasserlachen. Über uns ein weiter Sternenhimmel, gefüllt mit den ungewohnten Formationen der südlichen Hemisphäre. Ein Vollmond, der die Welt in ein kaltes, schattenloses Licht taucht. Immer wieder blicke ich mich um, versichere mich, das blinkende Licht in den Sträuchern bei unserem Beiboot nicht aus den Augen zu verlieren. Hier draußen die Orientierung zu verlieren ist lebensgefährlich. Kommt das Wasser zurück, ist es unmöglich, über das Riff zurück an Land zu gelangen, selbst wenn die Strömung uns zum Atoll treiben würde. Die Brandung am Riff würde uns zermalmen.
Unsere Hummerjagd geht schleppend voran. Die Tiere sind schwer auszumachen, außerdem besonders flink. Viele Weibchen tragen Eier. Wir verschonen sie. Als wir sechs Tiere – für jeden Jäger eines – gefangen haben, ist es zwei Uhr morgens. Die Flut hat eingesetzt, das Donnern der Brandung kommt näher. Höchste Zeit, den Rückzug anzutreten. Wir nehmen den kürzesten Weg, steuern direkt auf das blinkende Licht an Land zu, hüpfen über Korallenblöcke, waten durch hüfttiefe Pools. Erschrocken schreit David auf. Auf den Weg durch eine Wasserlache hat ihn ein eingeschlossener Hai in den Oberschenkel gerammt. David kommt mit dem Schrecken davon. Ich laufe von nun an lieber rund um die Ebbpools!
Zurück an Bord betrachten wir unseren Anteil der nächtlichen Jagd. David und Graig haben die größeren Hummer erhalten, sie müssen diese mit ihren schlafenden Bordfrauen teilen. Wir haben uns selbst zwei kleinere Tiere behalten, dazu zwei Trink-Kokosnüsse vom Motu mitgebracht. Die nächtliche Jagd hat uns hungrig gemacht, wir wollen nicht bis zum Morgen warten. Es ist ruhig am Ankerfeld, nur das Rauschen der Brandung ist zu hören. Leichter Wind streicht über die Boote, deren Ankerlichter sich leicht in der Bewegung wiegen. Was für ein inspirierendes Ambiente zum köstlichen Nachtmahl!
Die Tage verfliegen fast unbemerkt. Es ist Mitte Juni – Zeit, ein Stück weiter zu ziehen. Unter vollen Segeln überquert LA BELLE EPOQUE die Lagune von Fakarava, ankert vor dem Dorf an der Nordseite des Atolls. Wir kaufen ein paar Zwiebeln und Eier, trinken Mangosaft bei Rose, während ihre schlechte Internetverbindung langsam Wetterkarten am Notebook-Bildschirm aufbaut. Der Wetterbericht spricht von einem starken Passat. Wir werden die kommenden zweihundertfünfzig Seemeilen zügig vorankommen. Unser Ziel: Die Gesellschaftsinseln – das Herzstück jedes Südseetraums